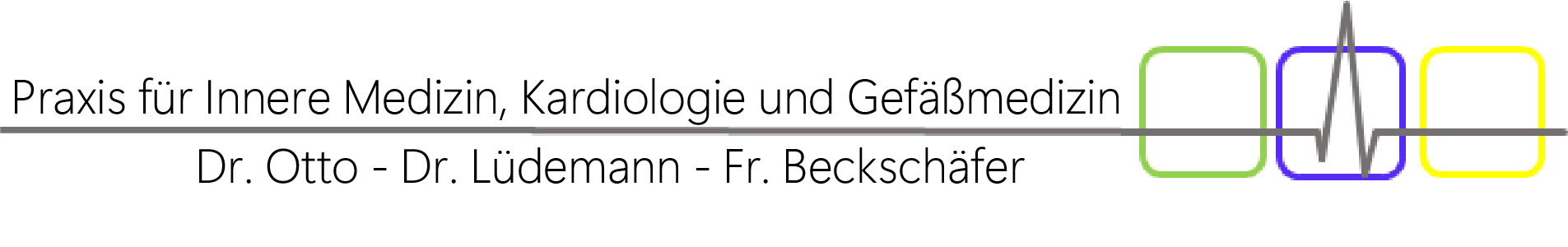Kardiologie | Kardiologische Untersuchung
Unsere kardiologischen Leistungen:
Echokardiografie
Die Echokardiografie ist eine Darstellung des Herzens mittels Ultraschall und eine der wichtigsten Basisuntersuchung. Neben der Größe des Herzens (Herzvergrößerung? Wandverdickungen?), der Struktur des Herzmuskels (Hinweis für Narbengewebe nach Herzinfarkt? Angeborene genetische Erkrankungen?) und der Pumpleistung des Herzens (Herzschwäche?), werden die Herzklappen, der Herzbeutel und die angrenzenden Blutgefäße wie Aorta, Lungenarterie und untere Hohlvene beurteilt.
Streß-Echokardiografie
In der „normalen“ Ruhe-Echokardiografie kann die Durchblutung des Herzens nicht dargestellt werden. Aussage über potentielle Herzkranzgefäßveränderungen können nur in seltenen Fällen beurteilt werden. Mittels Streß-Echokardiografie wird das Herz unter Belastung dargestellt. Dabei wird medikamentös die Herzfrequenz angehoben (je nach Alter bis zu 180/min). Dadurch steigt der Sauerstoffbedarf um ein Vielfaches an und relevante Durchblutungsstörungen zeigen sich, in dem die minderversorgten Areale aufhören mitzupumpen.
EKG-, Belastungs-EKG
Das EKG (Elektrokardiogramm oder „Herzschrift“) ist eine Aufzeichnung der elektrischen Aktivität der Herzmuskelzellen. Auch dies ist eine Basisuntersuchung bzgl. der Herzdiagnostik. Neben der Herzfrequenz und dem Herzrhythmus, lassen sich Abnormitäten der Reizleitung im Nervengewebe des Herzens ebenso darstellen, wie angeborene Herzerkrankungen die zu potentiell gefährlichen Rhythmusstörungen führen können. Darüber hinaus kann bereits im EKG ein abgelaufener Herzinfarkt entdeckt werden. Bei Rhythmusstörungen ist es wichtig, dass diese im EKG aufgezeichnet werden um eine Aussage über die Behandlungsnotwendigkeit und die Therapieoptionen benennen zu können.
Langzeit-EKG
Das Langzeit-EKG zeichnet den Herzrhythmus über 24h (in Ausnahmefällen auch länger) auf. Es ist keine Basisuntersuchung und wird nur bei bestimmten Fragestellungen verwendet (z.B. Herzfrequenz bei dauerhaften Vorhofflimmern, Herzrhythmusstörungen ohne Symptome bei genetischen Herzerkrankungen, Auffälligkeiten im Rahmen der Abklärung von Ohnmachtsanfällen, Rhythmusstörungen nach Bypass-OP oder Herzinfarkt). Häufig scheitert der Versuch Herzrhythmusstörungen aufzuzeichnen, da diese genau am Tag der Untersuchung natürlich nicht auftreten. Auch im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen hat das Langzeit-EKG keinen Stellenwert.
Schrittmacher-, Defibrillator (ICD)-, Bivent (CRT) -Schrittmacher-, Eventrekorderkontrolle und Programmierung
Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren müssen regelmäßig kontrolliert und die Programmierung ggfs. angepasst werden. Neben zwischenzeitlich aufgezeichneten Rhythmusstörungen wird der Batteriestatus, die Funktion der Kabel und die Programmierung überprüft. Bei „normalen“ Herzschrittmachern findet dies alle 6-12 Monate statt. ICD- und/oder Bivent-(CRT)-Schrittmacher sind meist bei schwerer vorerkrankten Patientinnen und Patienten implantiert und werden daher häufiger (alle 3-6 Monate) kontrolliert. Eventrekorder sind unter der Haut implantierte Geräte (ohne Kontakt zum Herzen) die lediglich Herzrhythmusstörungen aufzeichnen und abspeichern. Sie werden in der Regel genutzt um bei wiederholten Ohnmachtsanfällen potentielle Rhythmusstörungen als Ursache zu detektieren. Diese Geräte werden meist nur abgefragt, nachdem der Patient einen erneuten Ohnmachtsanfall hatte oder eine Selbstaufzeichnung ausgelöst hat.
Präoperative Diagnostik, Beratung, Vorbereitung
Sofern eine Herzoperation ansteht, berate ich Sie ausführlich über Grund für die Operation, Vorbereitung, Ablauf, Risiken (Pro und Contra der Operation), Nachsorge und potentielle Alternativen.
Ebenso sollten Patienten mit Herzvorerkrankung oder Risikopatienten vor einer OP jeglicher Art in Vollnarkose (höchstes Risiko bei großen Gefäß-, Bauch-, oder orthopädischen Eingriffen wie Hüftgelenksersatz) kardiologisch untersucht werden. Dabei geht es auch um die ggfs. notwendige Anpassung der Medikation vor bzw. während operativen Eingriffen.
Postoperative Nachsorge
Nach Herzeingriffen übernehme ich mit Sorgfalt die Nachsorge. Neben der Beurteilung der Wundheilung, geht es dabei um die Untersuchung auf Wasseransammlung in Herzbeutel oder Lungenfell, die Pumpleistung des Herzens, die Herzklappenfunktion und nach vermehrt auftretenden Herzrhythmusstörungen nach Herzoperationen. Außerdem erarbeiten wir gemeinsam, welche Belastung zu welchem Zeitpunkt die richtige ist und wie diese gesteigert werden kann. Häufig können auch initial noch notwendige Medikamente stufenweise reduziert oder abgesetzt werden.
Herzinsuffizienzbehandlung (Therapie der Herzschwäche)
In keinem Bereich der Kardiologie hat sich so viel entwickelt wie in der Behandlung der Herzschwäche (eingeschränkte Pumpleistung des Herzens). Bis in die 90er Jahre hatten Patienten mit relevanter Herzschwäche die Prognose eines Tumorpatienten. Durch eine Vielzahl medikamentöser Therapieoptionen, der Entwicklung und Therapieoptimierung von implantierbaren Defibrillatoren und Bivent- (CRT)- Schrittmachern, der invasiven Therapie mittels Verödung von Herzrhythmusstörungen oder Herzklappeneingriffen ohne „offene Operation“, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen drastisch gestiegen und viele Patienten betreue ich bereits seit über 15 Jahren. Durch diese Entwicklung ist die Behandlung aber auch immer komplexer geworden und bedarf einer individuellen Steuerung und Anpassung. Neben der Komplexität der Therapie liegen auf Patientenseite auch deutlich mehr Sorgen und Ängste vor. Hier ist eine vertrauliche, empathische enge Arzt- Patientbeziehung essentiell. Dafür steht das gesamte Praxisteam an ihrer Seite.
Herzkatheteruntersuchung, Coronarangiografie
Herzkatheter ist zunächst einmal ein Überbegriff verschiedener Untersuchung bei denen mit Hilfe eines dünnen Schlauchs über ein Gefäß (Arterie oder Vene, je nach Untersuchung) Zugang zum Herzen geschaffen wird. Die am häufigsten angewendete Methode ist die so genannte Coronarangiografie. Diese wird als Mittel der Wahl durchgeführt, wenn es um die Frage nach Durchblutungsstörungen des Herzens aufgrund von Gefäßverengungen der Herzkrankgefäße geht. Dabei wird von außen ein Kontrastmittel in die Herzkranzarterien gespritzt und dabei eine Röntgenaufnahme angefertigt. Dadurch werden Gefäßveränderungen sichtbar. Sofern dies notwendig ist, kann während der gleichen Untersuchung dann das Gefäß aufgedehnt werden und die Durchblutung wieder hergestellt werden. In der Regel wird zu Vermeidung einer Wiederverengung des Gefäßes ein so genannter Stent implantiert. Seltener wird eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt. Dabei werden die Drücke in den Herzvorhöfen bzw. -kammern ebenso wie in Lungenarterie und Hohlvenen gemessen und das Herzzeitvolumen (geförderte Blutmenge des Herzens pro Minute) gemessen.
Diagnostik und Behandlung von Herzrhythmusstörungen
Der Begriff „Herzrhythmusstörung“ ist zunächst einmal unspezifisch und ein Überbegriff für Abweichungen vom „normalen“ Sinusrhythmus. Die überwiegende Mehrheit der Herzrhythmusstörungen ist harmlos bzw. schränkt die Lebenserwartung nicht ein.
Dennoch ist die Darstellung der Rhythmusstörungen bzw. eine Herzdiagnostik notwendig, da die Rhythmusstörung zwar nicht gefährlich ist, aber Ausdruck einer behandlungsbedürftigen zugrunde liegenden Herzerkrankung sein kann. Oder es liegen Herzrhythmusstörungen vor, die zumindest einer Blutverdünnung bedürfen um das Risiko für Schlaganfälle und Embolien zu reduzieren (Vorhofflimmern).
Abklärung und Behandlung von Bluthochdruck (inkl. kompletter sekundäre Hypertoniediagnostik)
Bluthochdruck (Fachbegriff: Arterielle Hypertonie) zählt zu den Volkskrankheiten. Die Ursache ist meistens eine ungesunde Lebensweise und Übergewicht aber auch die Genetik (Vererbung) spielt eine große Rolle. Die Erkrankung macht häufig keine Symptome und wird eher im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen erkannt. Unbehandelt stellt die arterielle Hypertonie ein wesentliches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wir Herzinfarkt und Schlaganfall dar. Aber auch die Nieren reagieren empfindlich auf überhöhten Blutdruck. Unbehandelter oder ungenügend eingestellter Bluthochdruck ist nach wie vor einer der Hauptursachen für chronische Nierenschäden bis hin zur Dialysenotwendigkeit. Die Basistherapie besteht immer aus Ausdauersport, salzarmer Ernährung und Gewichtsnormalisierung. Bei dann weiterhin bestehenden erhöhten Blutdruckwerten sollte eine medikamentöse Therapie erfolgen. Die Wahl der Medikamente hängt von Begleiterkrankungen ab und sollte individuell besprochen werden.
Bei ca. 90% der Patienten ist eine Aussage über den Grund für den Blulthochdruck nicht möglich und man spricht von essentiellem Bluthochdruck. Bei einigen Patienten steckt jedoch eine Grunderkrankung dahinter. Wenn diese behandelt wird, ist auch der Blutdruck besser regulierbar. Diese Situation wird als sekundäre Hypertonie beschrieben. Auf die Abklärung dieser sekundären Hypertonie sind wir als Praxis spezialisiert. Neben einer Hormonanalyse der Nebennierenhormone, gehört zur Abklärung die Untersuchung auf ein Schlafapnoesyndrom (s. unten „Polygrafie“) und eine Gefäßdiagnostik der Nierenarterien und der Hauptschlagader (Aorta). Eine solche sekundäre Hypertonieabklärung sollte erfolgen, wenn trotz dreier verschiedener Medikamente der Blutdruck noch zu hoch ist oder wenn der Bluthochdruck bereits vor dem 40. LJ auftritt.
Eine spezielle Patientengruppe betrifft Schwangere mit Bluthochdruck. Auch hier sollte eine Ursachenforschung betrieben werden und eine engmaschige Kontrolle und fachärztliche Anbindung erfolgen. Ebenso ist eine entsprechende Nachsorge nach Entbindung wichtig.
Als zertifizierter Hypertensiologe (Bluthochdruckspezialist) der Deutschen Hochdruckliga steht Ihnen Dr. Otto in allen Fragen rund um Bluthochdruck zu Verfügung.
Disease Management Program (DMP) koronare Herzkrankheit (sofern nicht beim Hausarzt durchgeführt)
DMP dienen der Anbindung von Patienten mit entsprechender Grunderkrankung um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Die entsprechenden Untersuchungen werden dokumentiert und an eine zentrale Prüfstelle übermittelt. Die Praxen bekommen ein feed-back über ihre dokumentierten Patienten bzgl. erreichter Zielwerte. In der Regel werden diese DMP von den Hausarztpraxen übernommen. Sofern ihr Hausarzt dies nicht anbietet, können wir dies übernehmen. Die Einschreibung in dieses Programm bedarf immer der schriftlichen Patientenzustimmung und kann jederzeit beendet werden (ohne das Ihnen dadurch Nachteile entstehen). Erwähnt sei, dass unsere Patienten natürlich unabhängig von diesem Programm die optimale Versorgung erhalten und für uns eine Einschreibung am der Behandlung grundsätzlich nichts ändert.
Polygrafie = Diagnostik von Schlafapnoe
Die Polygrafie wird bei Verdacht auf nächtliche Atempausen eingesetzt um eine so genanntes Schlafapnoesyndrom zu diagnostizieren. Folgende Situationen sind typisch und sollten abgeklärt werden. Bluthochdruck unklarer Ursache oder bei ineffektiver Therapie (s.o. „Bluthochdruck“), starke Tagesmüdigkeit mit Einschlaftendenz (v.a. bei entsprechender beruflicher Gefahr wir Kraftfahrer etc.) oder Herzrhythmusstörungen unklarer Ursache.
Bei der Polygrafie bekommen Sie ein Gerät über Nacht mit nachhause. Dabei werden Atemfluß, Sauerstoffsättigung und Atembewegungen des Körpers ebenso wie die Körperlage und die Herzfrequenz gemessen. Diese ambulante Untersuchung macht eine Aufwendige Untersuchung im Schlaflabor nur notwendig, wenn wirklich ein Schlafapnoesyndrom nachgewiesen wird oder die Diagnostik unklar bleibt. Eine Vielzahl der Patient bedarf so keine Überweisung oder Diagnostik im Schlaflabor.
Fettstoffwechselerkrankungen
Pathologische Veränderungen im Fettstoffwechsel ist ein wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen bzw. Akutereignissen wir Herzinfarkt oder Schlaganfall. Für die Diagnose einer Fettstoffwechselstörung dient die Vorsorgeuntersuchung (Check-up 35). Bei bestehenden Veränderungen des Fettstoffwechsels sollte geklärt werden, ob bereits Gefäßveränderungen bzw. Folgeerkrankungen bestehen. Außerdem gilt es, nach weiteren Risikofaktoren (Bluthochdruck, Diabetes, Nikotin, Nierenschwäche, chronische Entzündungen…) zu suchen. Abhängig vom Gesamtrisiko gilt es dann individuell zu besprechen, in wie fern eine Senkung der Blutfettwerte (maßgeblich das LDL-Cholesterin) sinnvoll und notwendig ist und ob dies unterstützend medikamentös erfolgen sollte. Gerade im Bereich der Fettstoffwechselstörung und deren Therapie kursieren in den letzten Jahren viele Fehlinterpretationen und Falschaussagen in allen Formen der Medien. Dadurch ist die Verunsicherung auf Seiten von Betroffenen immens gestiegen. Ich beurteile und berate Sie als Patientin/ Patient ergebnisoffen. Neben einer individuellen Risikoanalyse, erhalten Sie alle Informationen um (gemeinsam) eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen.
Aortenaneurysmascreening
Der Begriff Aneurysma beschreibt eine pathologische Erweiterung eines Blutgefässes. Mit zunehmender Erweiterung steigt das Risiko für ein akutes Einreißen der Gefäßwand. Diese Situation ist lebensbedrohlich und geht mit den höchsten erkrankungsspezifischen Sterberaten einher. Da die Erweiterung häufig keine Beschwerden macht, sollten Risikogruppen auch ohne Symptome untersucht werden. Für Männer ab dem 65. Lebensjahr ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch und es gibt im Rahmen der Vorsorge den Anspruch auf eine einmalige Untersuchung der Bauchschlagader. Besonders betroffen sind Raucher/-innen und Menschen mit familiärer Vorbelastung. Sofern ein Aneurysma diagnostiziert wurde, gilt es die Risikofaktoren (Nikotin, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen) bestmöglich zu behandeln um ein Fortschreiten zu verhindern/ verlangsamen. Darüber hinaus sollten dann regelmäßige Kontrollen stattfinden um ggfs. mittels operativem oder interventionellem Eingriff das Aneurysma zu beseitigen. Bei Patientinnen und Patienten mit Aortenaneurysma sollten außerdem nach weiteren Herz- und Gefäßerkrankungen gesucht werden.
Sport-Check
Der Sport-Check richtet sich an Patienten mit Risikofaktoren, die (wieder) mit sportlicher Aktivität beginnen wollen.
Neben einer Diagnostik ob Herzkreislauferkrankungen vorliegen, die Einfluß auf die sportliche Aktivität haben, findet eine Beratung und Planung des geplanten Sportvorhabens statt. Dies ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Sprechen Sie uns gerne diesbezüglich an.
Tauchtauglichkeitsuntersuchung
Tauchen ist ein wunderschönes Hobby. Seriöse Tauchbasen verlangen eine Tauchtauglichkeitsbescheinigung. Und dies zu Recht. Das Risiko für Tauchzwischenfälle wird sehr häufig unterschätzt. Tauchen erhöht z.B. nachweislich das Risiko für plötzlich auftretendes Vorhofflimmern. Plötzliche Ereignisse in 15 Metern Tiefe sind lebensbedrohlich. Neben der Diagnostik und Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung berate ich Sie individuell über etwaige Risiken und Einschränkungen. Vor dem 14 und ab dem 41. LJ sollten die Untersuchungen jährlich erfolgen, bei gesunden Menschen zwischen 15 und 40 Jahren alle drei Jahre.
Typische kardiologische Erkrankungen:
- Koronare Herzkrankheit (Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße)
- Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern, -flattern, Extrasystolie, AV-Blockierungen…)
- Herzinsuffizienz (Herzschwäche)
- Herzklappenerkrankungen (Aortenstenose, Mitralinsuffizienz…)
- Cardiomyopathien/ Kanalopathien (HCM, HOCM, ncCM, DCM, Brugada, long-QT…)
- Bluthochdruck inkl. Sekundärer Hypertonien,
- Schwangerschaftshypertonie, Gestosenachsorge (nach
- „Schwangerschaftsvergiftung“) und Abklärung
- Lungenembolie und pulmonale Hypertonie
- Fettstoffwechselstörungen
- Synkopendiagnostik (anfallsartige Ohnmacht)
- Angeborene Herzerkrankungen und -fehlbildungen
Typische Symptome/ Befunde die kardiologisch abgeklärt werden sollten:
- Luftnot/ Minderbelastbarkeit
- Wasseransammlungen/ Ödeme
- Brustschmerzen, vor allem unter körperlicher Anstrengung
- Anfallsartige Rhythmusstörungen wie schneller Puls, Herzstolpern/ -aussetzer
- Risikopatienten oder herzerkrankte Patienten vor operativen Eingriffen
- Patienten mit einem oder mehreren Risikofaktoren (Fettstoffwechselstörung, chronische Nierenschwäche, Bluthochdruck, familiäre Häufung von Herzerkrankungen)
- Ohnmachtsanfälle
- Unklare Leberwerterhöhung (zum Ausschluß einer Rechtsherzschwäche)